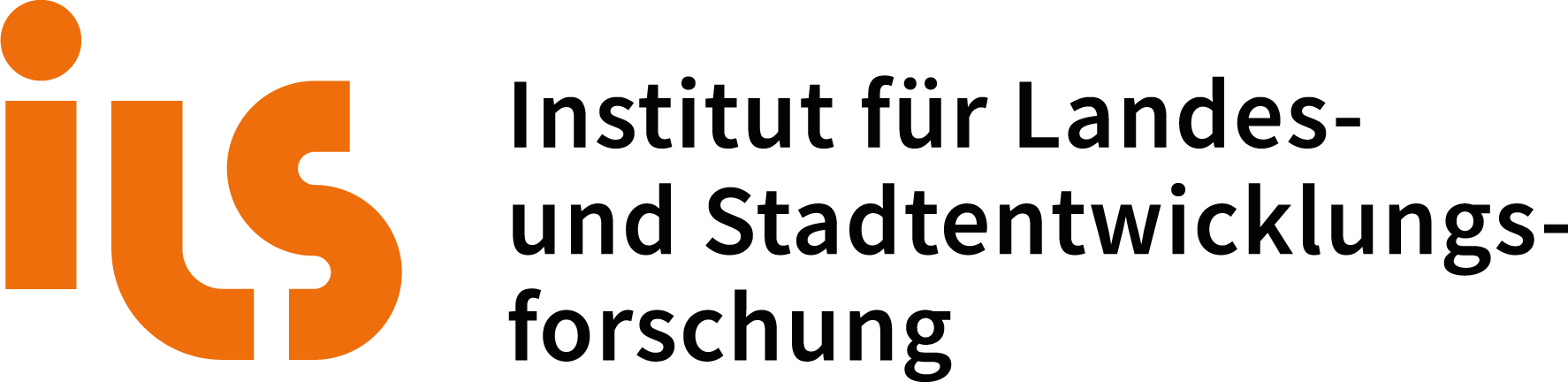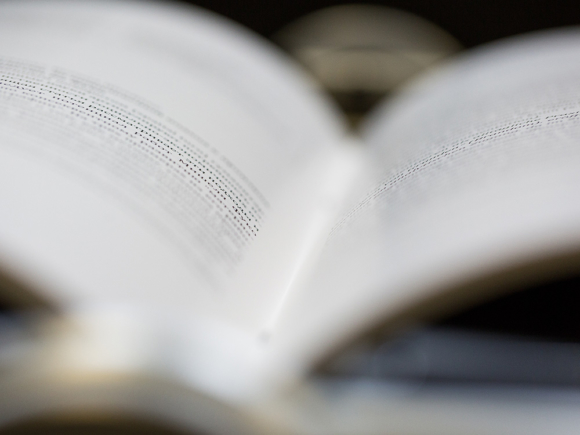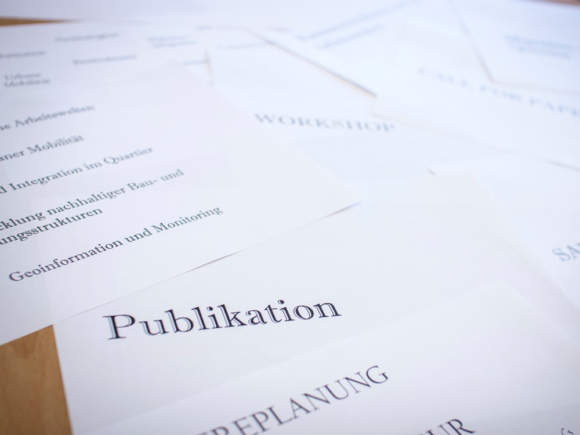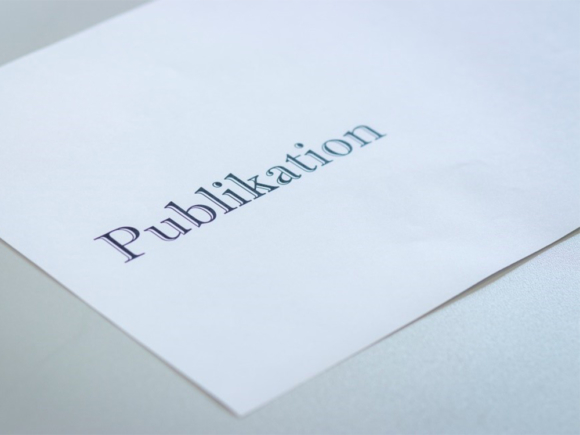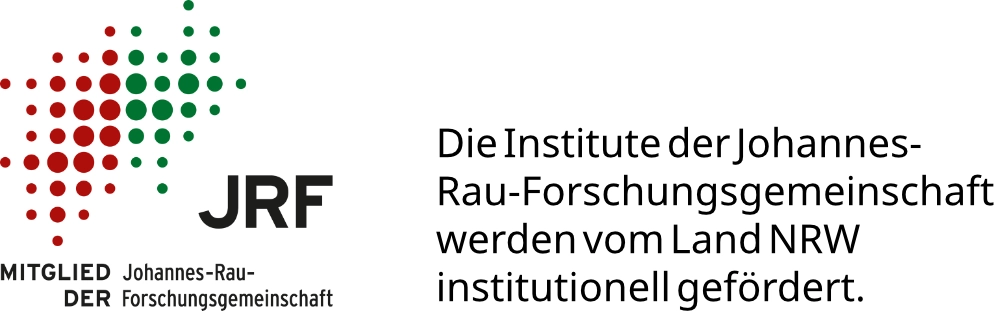Publikationen
Segregation an Grundschulen und die Produktion von Ungleichheit
ILS-Wissenschaftlerin Isabel Ramos Lobato hat gemeinsam mit anderen Kolleg*innen einen Artikel in der Fachzeitschrift sub/urban veröffentlicht. Der vorliegende Beitrag untersucht am Beispiel einer Großstadt in NRW die Ursachen von Grundschulsegregation. In vielen deutschen Städten zeigt sich auf der Grundschulebene ein zum Teil gravierendes Ausmaß an Segregation. Dies ist problematisch, da insbesondere in der Grundschule zentrale Weichenstellungen für die soziale Mobilität und den sozialen Zusammenhalt erfolgen. Basierend auf einer Kombination quantitativer und qualitativer Daten zeigt die Analyse, wie räumliche, individuelle und institutionelle Faktoren sowie deren Wechselwirkungen zur Entstehung und Verstärkung von Schulsegregation beitragen, und verdeutlicht damit die Komplexität der Segregationsprozesse im Bildungssystem. Ein besseres Verständnis dieser Wechselwirkungen ist nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive unerlässlich, sondern auch, um Maßnahmen zur Linderung von Schulsegregation zielgerichtet einsetzen zu können. https://doi.org/10.36900/suburban.v13i2/3.1025. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Energy renovation challenges in dense low-income neighbourhoods with fragmented ownership: insights from Dortmund–Nordstadt, Germany
ILS-Wissenschaftler Stefano Cozzolino hat gemeinsam mit Lisa Haag einen Artikel in der Fachzeitschrift „Town Planning Review“ veröffentlicht. In politischen Dokumenten wird die energieeffiziente Sanierung von Wohngebäuden zunehmend als globale Priorität genannt, die auf lokaler Ebene umgesetzt werden muss. Dieser Artikel untersucht die Herausforderungen bei der Umsetzung solcher energieeffizienten Sanierungsstrategien in dicht besiedelten, einkommensschwachen Stadtvierteln, die durch eine hohe Fragmentierung des Eigentums gekennzeichnet sind. Mit Fokus auf die Dortmunder Nordstadt kombiniert die Studie die Analyse räumlicher Daten und Politikdokumente sowie die intensive Zusammenarbeit mit privaten Eigentümer*innen und kommunalen Akteur*innen. Es werden die spezifischen Perspektiven privater Akteur*innen untersucht und gleichzeitig weiterrgehende Schlussfolgerungen für die Stadtplanung gezogen. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung kontextsensitiver Ansätze und weisen auf das Potenzial von quartiersspezifischen, niedrigschwelligen Beteiligungsformaten hin, um Maßnahmen zu erleichtern. https://doi.org/10.3828/tpr.2025.37. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
The impact of migration background and ethnicity on car, bus and bicycle use in England
Menschen mit Migrationshintergrund oder die sich selbst als zugehörig zu einer ethnischen Minderheit identifizieren zeigen in ihrem Alltag häufig eine andere Verkehrsmittelnutzung als die Bevölkerungsmehrheit. Warum das so ist, dazu gab es bisher kaum quantitative Studien in Europa und in Großbritannien. ILS-Wissenschaftlerin Janina Welsch und Giulio Mattioli von der TU Dortmund schließen diese Lücken mit der Analyse von Daten einer Umfrage in britischen Haushalten aus 2018–2019. Mit Hilfe von ordinalen Regressionsmodellen untersuchen sie den Einfluss der Migrationsgeneration und der ethnischen Zugehörigkeit auf die Häufigkeit der Nutzung von Autos, Bussen und Fahrrädern. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verkehrsverhalten je nach Migrationshintergrund und ethnischer Zugehörigkeit erheblich variiert, wobei letztere eine größere Rolle spielt. Mehr dazu: https://doi.org/10.1007/s11116-025-10696-5. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
„Neue“ Ankunftsräume zwischen Inklusion und Exklusion. Eine Literaturanalyse räumlicher Zuzugsmuster in Europa
Die ILS-Wissenschaftler*innen Hannah Brill, Isabel Ramos Lobato und Nils Hans haben gemeinsam mit Miriam Neßler und Heike Hanhörster von der TU Berlin einen Artikel in der Fachzeitschrift sub/urban veröffentlicht. In diesem Beitrag werden die räumlichen Auswirkungen der zunehmenden Diversifizierung von Migrationsprozessen analysiert. Im Fokus stehen dabei sich neuformierende Ankunftsräume in Europa jenseits „traditioneller“ urbaner Migrationszentren. Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse lassen sich fünf zentrale Dimensionen identifizieren, die die Ankunftsbedingungen für Neuzugewanderte vor Ort prägen. Der Beitrag plädiert für einen differenzierten Blick auf lokale Ankunftskontexte im Sinne des local turn in der Migrationsforschung, der die komplexen Wechselwirkungen zwischen lokalen und überörtlichen Bedingungen berücksichtigt. https://doi.org/10.36900/suburban.v13i2/3.1027. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Supporting the transformation of urban food systems: The food network of the city of Dortmund.
Die ILS-Wissenschaftlerinnen Melissa Leimkühler, Kathrin Specht, Chiara Iodice und Barbara Schröter haben einen Artikel in der Fachzeitschrift „Urban Agriculture & Regional Food Systems“ veröffentlicht. Der Artikel untersucht, wie das Dortmunder Ernährungssystem nachhaltig gestaltet werden kann. Im Zentrum stehen die wichtigsten Akteure, ihre Rollen und Beziehungen sowie die Hindernisse der Transformation. Die Analyse zeigt, dass eine enge Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft und Kommune entscheidend ist und der Ernährungsrat Dortmund eine zentrale Vernetzungsfunktion übernimmt. Für eine erfolgreiche Weiterentwicklung braucht es vor allem bessere Koordination, Finanzierung, politische Beteiligung, Sichtbarkeit und Networking. Die Ergebnisse liefern konkrete Impulse für die Stärkung urbaner Ernährungssysteme. https://doi.org/10.1002/uar2.70029. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Kreislaufwirtschaft im Verbund – Synergien zwischen Abwasser- und Lebensmittelwirtschaft
ILS-Wissenschaftler Thomas Weith, Ann-Kristin Koch und Melissa Leimkühler haben gemeinsam mit Julian Gatawis einen Artikel in der Fachzeitschrift „Geographische Rundschau veröffentlicht. Der Artikel untersucht, wie urbane Kreislaufwirtschaft Agrarsysteme entlasten kann: Klimawandel, Ressourcenknappheit und Flächendruck erhöhen den Bedarf an nachhaltigen Lösungen. Kläranlagen bieten großes Potenzial als Nährstoffquelle, doch bestehende Verfahren konzentrieren sich meist nur auf Phosphor. Anhand von NEWtrient®-Szenarien zeigt der Artikel, wie neue Konzepte Kläranlagen künftig besser in die Nährstoffversorgung integrieren können. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
The JUST GROW framework: conceptualizing how city regions can govern urban agriculture for equity and sustainability
Die ILS-Wissenschaftlerinnen Ann-Kristin Koch, Barbara Schröter und Kathrin Specht haben mit weiteren Kolleg*innen aus dem Projekt JUST GROW einen Artikel in der Fachzeitschrift „Frontiers in Sustainable Food Systems“ veröffentlicht. Der Artikel befasst sich mit einem neuen Rahmenkonzept für die Schaffung gerechtigkeitsorientierter Wege zur Steuerung und Förderung der nachhaltigen Transformation von stadtregionalen Ernährungssystemen (CRFS). Das JUST GROW-Rahmenkonzept integriert daher drei miteinander verknüpfte Gerechtigkeitsprinzipien in einen umfassenden Governance-Prozess, der kollektives Wissen, inklusive Beratung und bewusstes Handeln umfasst, und fordert offene und inklusive Mitgestaltungsprozesse unter Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen Interessengruppen, Entscheidungsträger*innen und Forscher*innen. https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1653448. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Gold mining in the Colombian Amazon: empirical insights on the links between sustainability, equity, and power
ILS-Wissenschaftlerin Barbara Schröter hat gemeinsam mit Kolleg*innen einen Artikel in der Fachzeitschrift „Sustainability Science“ veröffentlicht. In dem Artikel wird untersucht, wie unterschiedliche Vorstellungen von „nachhaltigem“ Goldabbau im kolumbianischen Amazonasgebiet zu Spannungen zwischen Unternehmen, Kleinbergbau, indigenen Gemeinschaften und staatlichen Akteuren führen. Die Studie zeigt, dass nachhaltige Lösungen nur möglich sind, wenn Machtverhältnisse und Gerechtigkeitsfragen berücksichtigt und vielfältige Perspektiven auf Nachhaltigkeit in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. https://doi.org/10.1007/s11625-025-01749-w. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Wie viel Reallabor steckt in den REGIONALEn in Nordrhein-Westfalen? Ein Format der Regionalentwicklung auf dem Prüfstand
Die ILS-Wissenschaftler Peter Stroms, Eyaiu Hassen und Thomas Weith sowie Luise Porst vom ZALF haben einen Artikel in der Fachzeitschrift disP – The Planning Review veröffentlicht. In dem Artikel geht es um Reallabore, die einen wichtigen Beitrag zur Initiierung, Erforschung und Umsetzung transformativer Prozesse innerhalb der Gesellschaft leisten können. In diesem Zusammenhang stellt die REGIONALE in Nordrhein-Westfalen ein hochinteressantes Format dar, da sie häufig innovative und experimentelle regionale Entwicklungsprojekte und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Akteuren hervorgebracht hat. Anhand der Entwicklung einer Reihe von Kriterien für Reallabore untersucht dieser Artikel die Gemeinsamkeiten zwischen der REGIONALE und dem Reallabor-Ansatz und diskutiert sowohl die möglichen Chancen als auch die Herausforderungen, die die Reallabor-Perspektive für die REGIONALE und damit für die formatorientierte Regionalentwicklung mit sich bringen könnte. https://doi.org/10.1080/02513625.2025.2561515. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Stadt-Umland-Kooperation: zur Praxis gesetzlich etablierter Stadt-Umland-Räume in Mecklenburg-Vorpommern
ILS-Forschungsgruppenleiter Thomas Weith hat gemeinsam mit Wolfgang Köck vom UFZ und Annelie Gütte vom ZALF einen Artikel in der Fachzeitschrift STANDORT veröffentlicht. Basierend auf dem ReGerecht-Projekt werden in dem Artikel institutionalisierte Stadt-Umland-Kooperationen am Beispiel Schwerin analysiert. Stadt-Land-Verflechtungen sind ein zentrales Thema in Planung und Forschung. Die über die Landesplanung formalisierten Stadt-Umland-Räume (SUR) in Mecklenburg-Vorpommern stellen einen bislang wenig beachteten Sonderfall dar. Die Analyse des Stadt-Umland-Raums Schwerin zeigt: Durch die institutionelle Verankerung haben sich funktionierende Kooperationsräume und Abstimmungsroutinen etabliert. Der Ansatz erleichtert den Interessenausgleich und bietet Potenzial für die Übertragung auf andere Bundesländer. https://doi.org/10.1007/s00548-025-01014-3. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.