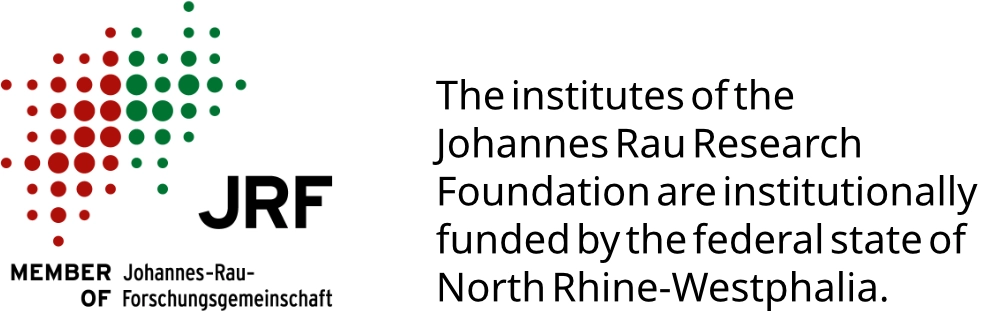Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
Vortrag in Wien: Urbane Mobilität und wahrgenommene Erreichbarkeit
ILS-Wissenschaftlerin Dr. Anna-Lena Stroms-van der Vlugt war diese Woche zu Gast bei der Österreichischen Geographischen Gesellschaft in Wien. Ihr Vortrag beleuchtete, wie eine fußgängerfreundliche und inklusive Stadt- und Verkehrsplanung die Lebensqualität und unabhängige Mobilität der Bürger*innen stärken kann. Dabei ging es auch um Methoden zur Erfassung von objektiver und wahrgenommener Erreichbarkeit. Mehr…
Vortrag in Wien: Urbane Mobilität und wahrgenommene Erreichbarkeit
ILS-Wissenschaftlerin Dr. Anna-Lena Stroms-van der Vlugt war diese Woche zu Gast bei der Österreichischen Geographischen Gesellschaft in Wien. Ihr Vortrag beleuchtete, wie eine fußgängerfreundliche und inklusive Stadt- und Verkehrsplanung die Lebensqualität und unabhängige Mobilität der Bürger*innen stärken kann. Dabei ging es auch um Methoden zur Erfassung von objektiver und wahrgenommener Erreichbarkeit.
Der Vortrag zeigte die planerischen Implikationen einer stärker wahrnehmungsbasierten Erreichbarkeitsforschung auf und diskutierte ihr Potenzial, eine Verlagerung vom Pkw hin zu öffentlichem Verkehr, Fahrrad- und Fußverkehr zu unterstützen – immer vor dem Hintergrund: „Why and how perceptions matter“.
Weitere Informationen gibt es im Flyer der ÖGG.
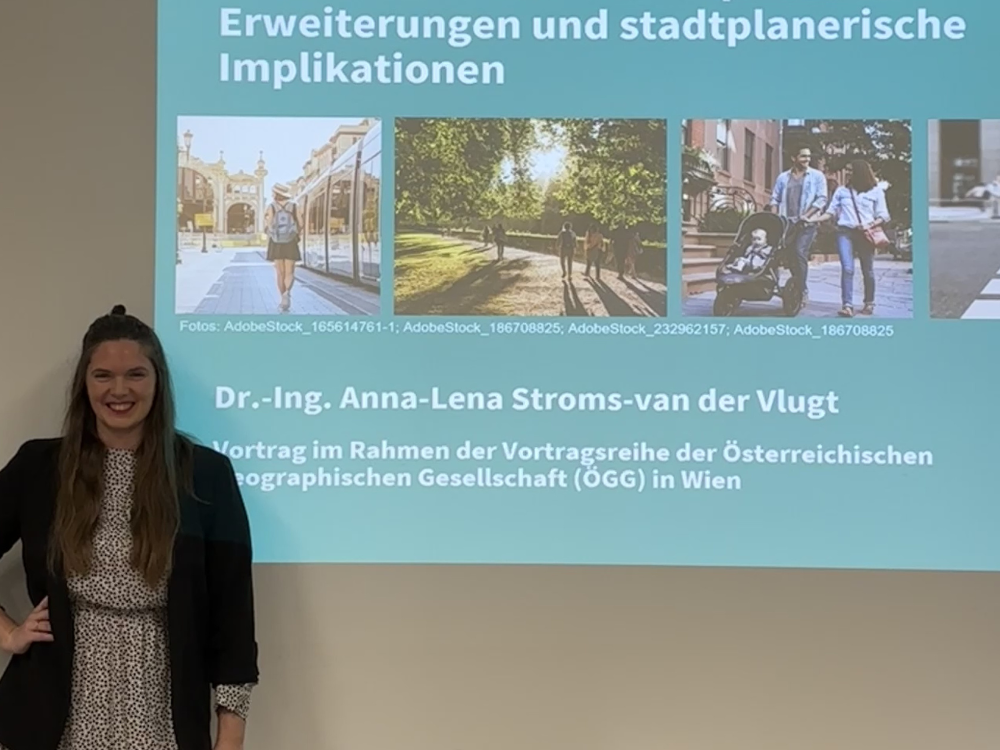
ILS-Forschungsstrategie 2025+: Urbanen Wandel verstehen, urbanen Wandel gestalten
„Urbanen Wandel verstehen, urbanen Wandel gestalten“ – dieses Motto prägt unsere Arbeit als ILS. Wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis. Mit anwendungsorientierter Forschung und evidenzbasierter Beratung unterstützen wir Städte und Regionen dabei, komplexe Herausforderungen nachhaltig, gerecht und zukunftsfähig zu bewältigen. Mit der vorliegenden Forschungsstrategie 2025+ formulieren wir die strategische Weiterentwicklung des ILS. Mehr…
The impact of migration background and ethnicity on car, bus and bicycle use in England
People with a migration background and/or who identify themselves with an ethnic group tend to have different travel behaviour in comparison to the population majority. A better understanding of this nexus is needed, yet there is a lack of quantitative studies on this topic in Europe and in the United Kingdom. ILS researcher Janina Welsch and Giulio Mattioli from TU Dortmund fill this gap by analysing data from the 2018–2019 wave of the UK House-hold Longitudinal Survey. With ordinal regression models, they investigate the impact of migration generation and ethnicity on the frequency of car, bus, and bicycle use. The results show that travel behaviour varies substantially depending on migration background and ethnicity, with the latter playing a larger role. More: https://doi.org/10.1007/s11116-025-10696-5. Further current selected papers can be found here.
„New“ arrival spaces between inclusion and exclusion. A literature anal-ysis of spatial migration patterns in Europe
ILS researchers Hannah Brill, Isabel Ramos Lobato, and Nils Hans, together with Miriam Neßler and Heike Hanhörster from TU Berlin, have published an article in the journal sub/urban. This article analyzes the spatial effects of the increasing diversification of migration processes. The focus is on newly forming arrival areas in Europe beyond „traditional“ urban migration centers. Based on a systematic literature review, five central dimensions can be identified that shape the local arrival conditions for newcomers. The article argues for a differentiated view of local arrival contexts in the sense of the „local turn“ in migration research, which takes into account the complex interactions between local and supra-local conditions. https://doi.org/10.36900/suburban.v13i2/3.1027. Further current selected papers can be found here.