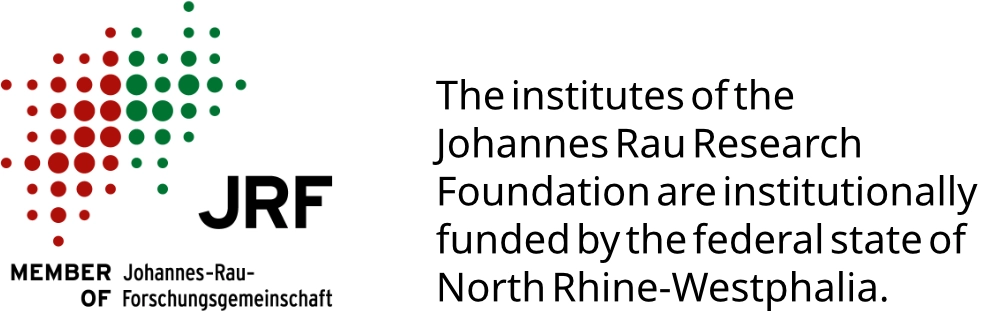Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
Fachforum „Wohnen macht Stadt“: Zukunft großer Siedlungen: Städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Herausforderungen im Bestand
Große Siedlungen, wozu Nachkriegssiedlungen der 1950er Jahre in Zeilenbauweise sowie Großwohnsiedlungen aus den 1960er, 1970er und frühen 1980er Jahren zählen, sind unverzichtbarer Bestandteil des Wohnungsangebots in Nordrhein-Westfalen. Sie stehen angesichts demografischer Veränderungen, steigender Anforderungen an Klimaanpassung und energetische Sanierung sowie veränderter Wohnbedürfnisse vor komplexen Herausforderungen. Ihre großmaßstäblichen Strukturen, oft klaren Eigentumsverhältnisse und gewachsenen Nachbarschaften bieten zugleich Chancen, sie als vielfältige, lebenswerte und sozial gerechte Wohnorte weiterzuentwickeln. Beim Fachforum am 20. Mai in Dortmund wollen wir gemeinsam diskutieren, welche politischen, planerischen und wohnungswirtschaftlichen Rahmenbedingungen diese transformative Weiterentwicklung großer Siedlungen ermöglichen, wie Kooperationen zwischen Kommunen, Wohnungsunternehmen und Zivilgesellschaft gelingen können und wie sich Zielkonflikte konstruktiv moderieren lassen. Weitere Informationen und Anmeldung
„Agrarsysteme der Zukunft“ und „PlanTieFEn“ beim Zukunftsforum in Berlin
Wie können Konflikte um Landnutzung konstruktiv bearbeitet werden und wie sehen neue Wege für ein vorausschauendes, kooperatives Flächenmanagement aus? Auf dem Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hatte das Team von „Agrarsysteme der Zukunft“ die Möglichkeit, das Fachforum 28 „Flächen im Wandel“ mitzugestalten – gemeinsam mit dem Öko-Institut, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ), neuland21 und der Wüstenrot Stiftung.
Im Mittelpunkt standen Impulse zu erneuerbaren Energien, Reallaboren in Landwirtschaft, Ernährung und ländlichen Räumen sowie methodischen Tools zur Konfliktbearbeitung, die im Anschluss in Arbeitsgruppen mit den Teilnehmenden vertieft und in praxisnahe Handlungsempfehlungen übersetzt wurden.
Besonders spannend war der Workshop zu Experimentierräumen und Innovationen: Es wurde diskutiert, wie Reallabore helfen können, lokale Konflikte und Nutzungskonkurrenzen zu bearbeiten, Planungsspiele sinnvoll einzusetzen und Emotionen sowie sozio-kulturelle Transformation bewusster in Prozesse einzubeziehen.
Es wurden aus dem ILS auch die Teilergebnisse des Projekts PlanTieFEn-präsentiert. Sarah Friese und Jonas Marschall waren vom ILS vor Ort, Dr. Melanie Mbah vom Öko-Institut hat die Zwischenergebnisse dem Publikum vorgestellt.
Zentral war auch die Frage, wie Reallabore konkret umgesetzt werden können – etwa durch Reallabor-Manager*innen, klare Roadmaps und Ansätze der Hilfe zur Selbsthilfe.
So zog Prof. Dr. Thomas Weith vom ILS das Fazit: „Es lohnt sich, über klassische Beteiligungsformate hinauszugehen, neue Formate auszuprobieren und Menschen zu ermutigen, sich zu öffnen und aktiv an Innovationsprozessen mitzuwirken.“

Gruppenfoto_Copyright Schreiner IGZ Agrarsysteme der Zukunft
Foto: Schreiner/IGZ
„Agrarsysteme der Zukunft“ und „PlanTieFEn“ beim Zukunftsforum in Berlin
Wie können Konflikte um Landnutzung konstruktiv bearbeitet werden und wie sehen neue Wege für ein vorausschauendes, kooperatives Flächenmanagement aus? Auf dem Zukunftsforum Ländliche Entwicklung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hatte das Team von „Agrarsysteme der Zukunft“ die Möglichkeit, das Fachforum 28 „Flächen im Wandel“ mitzugestalten – gemeinsam mit dem Öko-Institut, dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau (IGZ), neuland21 und der Wüstenrot Stiftung. Mehr…
The Reputation of Primary Schools—Rumours with Consequences for Segregation
ILS researcher Isabel Ramos Lobato and Andreas Wettlaufer (Ruhr-Universität Bochum) have published an article in the journal Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Taking up previous research, the article uses a mixed-methods design to investigate how the reputations of primary schools are established in discourses in a German neighbourhood in North Rhine-Westphalia and what role they play in school choice. It becomes clear that, in contrast to previous studies, the reputations of the local schools generally reflect their composition. Even if this does not mean that reliable conclusions about a school’s quality can actually be drawn from it, reputation is a very important school selection criterion across all social groups. Nevertheless, perceptions of individual primary schools vary in line with parents’ educational qualifications, contributing to school segregation. https://doi.org/10.1111/tesg.70060. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie here.
Entrepreneurs’ ‘Triadic Spatial Paradox’: theorising the hybrid home‑based business workspace experience
ILS researcher Cornelia Tippel and her colleagues have published an article in the International Small Business Journal: Researching Entrepreneurship. The article examines the significance of space in entrepreneurship and develops the conceptual model of the ‘Triadic Spatial Paradox’ based on the experiences of entrepreneurs operating home-based businesses (HBBs). It shows how entrepreneurs personally relate to and make sense of their dynamic hybrid home/workspaces and how they articulate the space-related paradoxes within their businesses. https://doi.org/10.1177/02662426251410801. Further current selected papers can be found here.