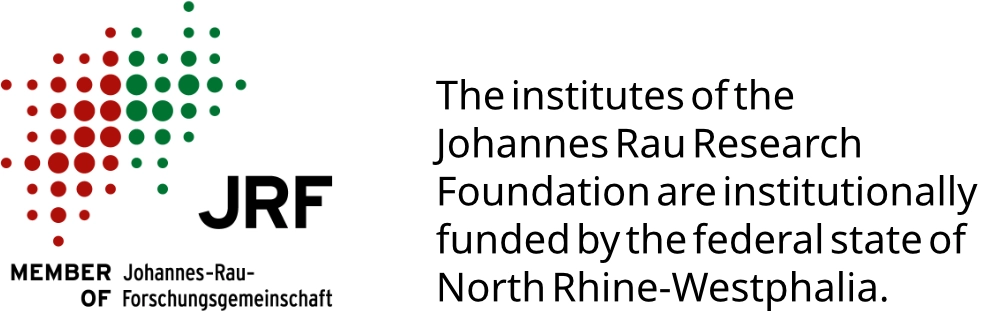Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
Lokale Begegnung im Kreis Gütersloh fördern
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergründen leben im Kreis Gütersloh zusammen. Unter dem Titel ‚Lokale Begegnung gestalten – auf dem Weg zu gelebter Teilhabe vor Ort‘ lud das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Gütersloh am vergangenen Mittwoch Fachkräfte und Ehrenamtliche zu einem Impulsforum ein. Ralf Zimmer-Hegmann (ILS) hielt dort die Keynote „Begegnung, Quartier, Integration –drei Dinge, die zusammengehören“. Mehr…
Lokale Begegnung im Kreis Gütersloh fördern
Menschen mit unterschiedlichen kulturellen, religiösen oder sozialen Hintergründen leben im Kreis Gütersloh zusammen. Unter dem Titel ‚Lokale Begegnung gestalten – auf dem Weg zu gelebter Teilhabe vor Ort‘ lud das Kommunale Integrationszentrum des Kreises Gütersloh am vergangenen Mittwoch Fachkräfte und Ehrenamtliche zu einem Impulsforum ein.
Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie die persönliche Begegnung von unterschiedlichen Menschen gefördert werden kann, um Vorurteile abzubauen und das gegenseitige Verständnis zu stärken. Ralf Zimmer-Hegmann, Kommissarischer wissenschaftlicher Leiter und Geschäftsführer des ILS, betonte in seiner Keynote die Bedeutung der Begegnung im Quartier für die soziale und kulturelle Integration. Mit der Schaffung von gut erreichbaren und kostenfreien Angeboten vor Ort und der Vernetzung von Einrichtungen und Akteuren nannte er konkrete Möglichkeiten für den Kreis, um dies zu fördern.
Weitere Informationen zum Impulsforum finden Sie hier.
15-MinutenStadt – Von der Idee bis zur Umsetzung
Beim JRF-WissensLunch Ende Oktober hat ILS-Wissenschaftler Dr. Thomas Klinger über die Idee der 15-Minuten-Stadt gesprochen. Aber nicht nur die Entstehung der Idee war Thema, sondern auch Beispiele aus der Praxis, wie die 15-Minuten-Stadt umgesetzt werden kann. Die Aufzeichnung des Digitalen JRF-WissensLunch gibt es hier.
ILS auf der NRW-Nachhaltigkeitstagung
Bereits zum 11. Mal lädt das NRW-Umweltministerium zur Nachhaltigkeitstagung ein. Am 4. Dezember stehen in der Stadthalle Mühlheim aktuelle Erkenntnisse der Forschung, Best-Practice-Beispiele und die Vernetzung zu verschiedenen Themen rund um Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Das ILS ist wieder mit einem Stand vertreten. Wir geben dort Einblicke in unsere Begleitforschung zum Landeswettbewerb „ways2work“ sowie in das Projekt FoodConnectRuhr. Mehr…
ILS auf der NRW-Nachhaltigkeitstagung
Bereits zum 11. Mal lädt das NRW-Umweltministerium zur Nachhaltigkeitstagung ein. Am 4. Dezember stehen in der Stadthalle Mülheim aktuelle Erkenntnisse der Forschung, Best-Practice-Beispiele und die Vernetzung zu verschiedenen Themen rund um Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Das ILS ist wieder mit einem Stand vertreten.
Wir geben dort Einblicke in unsere Begleitforschung zum Landeswettbewerb „ways2work“ sowie in das Projekt FoodConnectRuhr. Ways2work soll die Anbindung von Gewerbegebieten gezielt verbessern und umfassende Mobilitätsmanagementkonzepte entwickeln, damit die Mobilitätswende auch auf Arbeitswegen gelingen kann. FoodConnectRuhr bringt nach dem Prinzip „Vom Acker bis zum Teller“ Akteurinnen aus der Land- und Ernährungswirtschaft mit Lebensmittelverbraucher*innen zusammen, um Angebot und Nachfrage nachhaltiger Lebensmittel innerhalb der Modellregion zu verknüpfen.