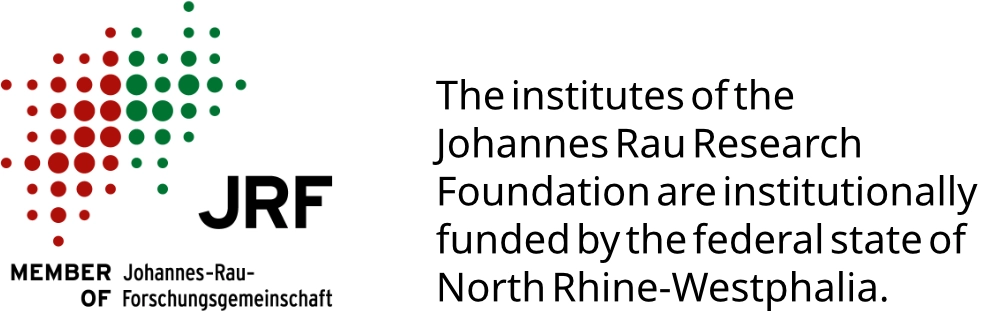Zeitz, Jana Friederike
Jana Friederike Zeitz, M.Sc. Geography
(area of specialisation: Urban and Regional Development Management)

Studied Geography with specialisation on Urban and Regional Development at the Department of Geography, Ruhr University Bochum.
Research interests:
- The right to the city
- Social and spatial inequality
- Urban and neighbourhood development planning
- Housing market and allocation strategies
Contact:
Phone: + 49 (0) 231 9051-244
E-Mail: jana.zeitz@ils-research.de
WalkUrban Final Conference
You are currently seeing a placeholder content of Eveeno. To access the actual content, click on the button below. Please note that data will be passed on to third-party providers.
At our final conference we present our research approach and findings, and explore policy implications and future implementations for creating walking-friendly neighbourhoods. Based on our research findings we will also discuss the transfer¬ability of research methods, outcomes and policy implications to other European countries beyond the cities studied. In WalkUrban we investigated objective and perceived walkability in six neighbourhoods in three European cities: Genoa in Italy, Dortmund in Germany, and Gothenburg in Sweden.
Final Conference Programme
Venue: Ground floor conference room at ILS Research gGmbH, Brüderweg 22-24, 44135 Dortmund, Germany
Date: 6th March 2024 (hybrid) and Thursday 7th March 2024 (in-person)
Day 1 Sessions (13:30 – 18:00) Hybrid
| 13:00 – 13:30 | Welcome coffee |
| 13:30 – 13:40 | Welcome adress |
| 13:40 – 14:00 | Introduction to WalkUrban project |
| 14:00 – 14:20 | Key findings from quantitative methods: spatial modelling and household survey |
| 14:20 – 14:40 | Key findings from qualitative method: walk-alongs |
| 14:40 – 15:00 | Coffee break |
| 15:00 – 16:40 | Introduction to case study cities and discussion on local policy implications: Genoa, Gothenburg and Dortmund |
| 16:40 – 16:50 | Citizen science tool for walking route assessment |
| 16:50 – 17:00 | Final remarks |
| 17:00 – 18:00 | Reception at ILS |
Day 2 Sessions (9:30 – 12:30) in person
| 9:00 – 9:30 | Welcome coffee |
| 9:30 – 11:30 | Scientific discussion on project findings and transferability |
| 11:30 – 12:30 | Field visit in Kreuzviertel, Dortmund |
| 12:30 | Lunch (optional) |
Autoreduzierte Quartiersentwicklung als neuer Planungsstandard? Potenziale, Hemmnisse, Übertragbarkeit
Autoreduzierte Quartiersentwicklung als neuer Planungsstandard? Diese Frage steht über der Fachveranstaltung am 30. November in Köln. Anhand von Zwischenergebnissen des Forschungsprojektes „Nachhaltige Mobilität in Lincoln 2: Implementierung innovativer nachhaltiger Mobilitätskonzepte in Neubausiedlungen und Konversionsflächen am Beispiel der Lincoln-Siedlung in Darmstadt (NaMoLi 2)“ werden dort Chancen und Herausforderungen einer autoreduzierten Quartiersentwicklung diskutiert. Expert*innen kommentieren diese Erkenntnisse und diskutieren gemeinsam mit den Teilnehmenden die Übertragbarkeit von Konzept und Planungsprozess auf andere Neubauquartiere. Zur Anmeldung
“The kids get haggled over“: How institutional practices contribute to segregation in elementary schools
ILS-Wissenschaftlerin Isabel Ramos Lobato hat gemeinsam mit Alina Goldbach und Heike Hanhörster einen Artikel in der Fachzeitschrift „Frontiers in Sociology“ veröffentlicht. Darin wird erörtert, wie institutionelle Praktiken zur Segregation in Grundschulen beitragen.
https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1250158.
Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.
Autoreduzierte Quartiersentwicklung als neuer Planungsstandard?

© Thorsten Friedrich, HEAG Mobilio GmbH
Potenziale, Hemmnisse, Übertragbarkeit
30. November 2023
15:00 – 18:00 Uhr
Kranhaus Nord, Im Zollhafen 12, 50678 Köln
Das Leitbild der autogerechten Stadt sowie die über Jahrzehnte daran ausgerichtete Planung und Politik prägen die Stadtentwicklung in Deutschland bis heute. Die negativen Konsequenzen werden insbesondere in Großstädten deutlich. Autoreduzierte Quartiere können als Entwicklungen verstanden werden, die diese autofokussierte Planung in Frage stellen. Attraktive alternative Mobilitätsangebote sowie einschränkende Maßnahmen gegenüber dem fahrenden und parkenden Kfz-Verkehr sind bekannte Bausteine nachhaltiger Mobilitätskonzepte für Stadtquartiere.
Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich bei der Planung und Umsetzung autoreduzierter Quartiere in der Praxis?
Welchen Einfluss kann die Umsetzung nachhaltiger Mobilitätskonzepte auf das Mobilitätsverhalten von Bewohner*innen haben?
Welche Rolle spielen die Überzeugungen der involvierten Akteur*innen (z.B. aus der Verwaltung oder Wohnungswirtschaft) bei der autoreduzierten Planung?
Diesen Fragen gehen wir anhand von Zwischenergebnissen des Forschungsprojektes „Nachhaltige Mobilität in Lincoln 2: Implementierung innovativer nachhaltiger Mobilitätskonzepte in Neubausiedlungen und Konversionsflächen am Beispiel der Lincoln-Siedlung in Darmstadt (NaMoLi 2)“ nach. Expert*innen kommentieren diese Erkenntnisse und diskutieren gemeinsam mit den Teilnehmenden die Übertragbarkeit von Konzept und Planungsprozess auf andere Neubauquartiere.
Programm
| 14:30 Uhr | Empfang und Registrierung |
| 15:00 Uhr | Begrüßung: Dr. Thomas Klinger, ILS |
Reallabor Darmstadt: Etablierung eines multimodalen Mobilitätskonzeptes in der Lincoln-Siedlung
| 15:15 Uhr | Vortrag: Hanna Wagener, Wissenschaftsstadt Darmstadt |
| 15:35 Uhr | Kommentar: Ralph Herbertz, VCD NRW / Bündnis kommunale Nachhaltigkeit Köln & Diskussion im Plenum |
| 15:55 Uhr | Pause |
Veränderungen des Mobilitätsverhaltens – Eine Evaluation der Wirksamkeit des Mobilitätskonzepts Lincoln
| 16:00 Uhr | Vortrag: Marcus Klein & Simon Werschmöller, Goethe-Universität Frankfurt am Main |
| 16:20 Uhr | Kommentar: Dr. Tobias Bödger, Zukunftsnetz Mobilität NRW & Diskussion im Plenum |
| 16:40 Uhr | Pause |
Von autoorientierter zu autoreduzierter Planung: Akteure und ihre Überzeugungen am Beispiel Lincoln
| 16:55 Uhr | Vortrag: Annika Schröder, ILS Research |
| 17:15 Uhr | Kommentar: Stephanie Dietz, Stadt Köln & Diskussion im Plenum |
Facetten autoreduzierter Quartiersentwicklung und Übertragbarkeit
| 17:35 Uhr | Abschlussdiskussion |
| 18:00 Uhr | Ende |
Moderation: Dr. Thomas Klinger, ILS
You are currently seeing a placeholder content of Eveeno. To access the actual content, click on the button below. Please note that data will be passed on to third-party providers.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Wir bitten jedoch zur besseren Planbarkeit um verbindliche Anmeldung bis zum 23. November 2023.
Flyer
Weitere Informationen finden Sie im Flyer.
Veranstalter
ILS Research gGmbH
Die Fachveranstaltung findet im Rahmen des Projektes NaMoLi 2 statt, das von der Wissenschaftsstadt Darmstadt, dem Institut für Humangeographie der Goethe-Universität Frankfurt und der ILS Research gGmbH durchgeführt und vom Bundesministerium für Forschung und Bildung gefördert wird.
Kontakt / Informationen
Annika Schröder (bei fachlichen Fragen)
+49 (0)231 9051-234
Annika.Schroeder@ils-forschung.de
Sabine Giersberg (Veranstaltungsmanagement)
+49 (0)231 9051-275
veranstaltung@ils-forschung.de
Sinkende Einzelhandelsmieten in Innenstädten – Ausdruck der Krise oder Chance für Wiederbelebung?
Kati Volgmann und Frank Osterhage, Wissenschaftler*innen aus der FG M, haben gemeinsam einen Artikel in der Zeitschrift „Stadtforschung und Statistik“ veröffentlicht. Der Beitrag zeigt, dass es konkrete Anzeichen für eine nachlassende Attraktivität der Innenstädte gibt und dass Marktanpassungsprozesse, sinkende Einzelhandelsmieten und zunehmende Leerstände nicht nur in Großstädten, sondern auch in Mittel- und Kleinstädten zu beobachten sind. Weitere aktuelle Fachpublikationen finden Sie hier.